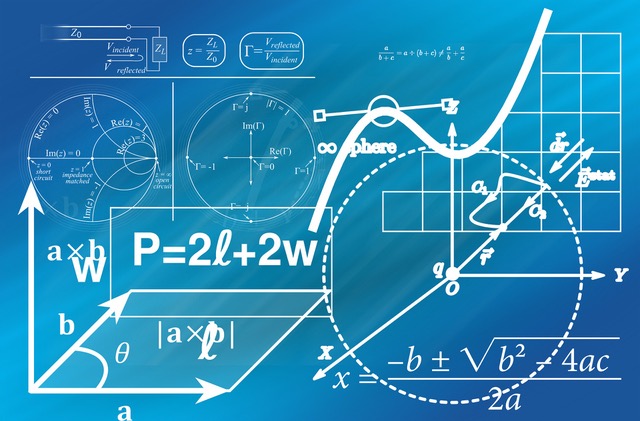Komplexer Langzeitvertrag – aber wie?
Der Werkliefervertrag einer Rollmaterial-Flottenbeschaffung ist normalerweise ein massives Werk. Im Fall FV_Dosto handelt es sich um ein 60 Seiten starkes Vertragswerk (Grundvertrag) mit 31 Anhängen und zusätzlichem Umfang von über 300 Seiten. Der wichtige Anhang „bereinigter Anforderungskatalog“ – das eigentliche Herz der geschuldeten Leistung – umfasst über 1000 ausformulierte technische Anforderungskriterien, die wiederum eine Vielzahl von technischen Normen referenzieren, die so indirekt Vertragsbestandteil werden. Die Offerte der Lieferantin mit all ihren Anhängen ist qua Hierarchieregelung Vertragsbestandteil, allerdings nur subsidiär. Im Fall von Widersprüchen geht der Vertrag anderen Vertragsbestandteilen vor. Bedenkt man nun, dass der Vertrag nicht für die Schublade bestimmt ist – wie man gerne immer wieder aus erfolgreichen Projekten hört – sondern sehr konkret und präzise Leistung und Gegenleistung, insbesondere auch deren Abhängigkeiten zu definieren hat liegt es auf der Hand, dass ihm eine äusserst wichtige Rolle zukommt. Das tägliche Brot der involvierten Juristen dreht sich im Langzeitprojekt zwangsläufig um Interpretationsfragen, Vertragslücken oder qualifiziertes Schweigen der Vertragsredaktoren. Im Fall der Rollmaterialbeschaffungen befinden sich diese v.a. auf der Beschaffungsseite, sind doch die Vertragsvorlagen vorgeschrieben, unverhandelbar, prophetisch in Stein gemeisselt und damit diskussionslos, unter Androhung des Ausschlusses zu akzeptieren. Und das bei Projekten deren Arbeitsergebnisse eine Lebenserwartung von 40 Jahren aufweisen müssen.
Wann ist ein Vertrag komplex und auf lange Frist ausgelegt?
Das Obligationenrecht unterscheidet Vertragstypen, die mehr oder minder komplex sein können. So darf davon ausgegangen werden, dass ein Werkvertrag grundsätzlich komplexer ist als ein Kaufvertrag, weil das Arbeitsergebnis im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht greifbar ist im Gegensatz zum Kaufgegenstand, den der Käufer zumindest sieht und begreifen kann. Ein Auftrag umgekehrt erfordert kaum Spezifikationen zum Inhalt und Gegenstand des Tätigwerdens des Beauftragten, geht es doch hier primär um die Person des Beauftragten und seine Qualifikationen. Mischformen aus diesen Vertragstypen sind oft anzutreffen, was zur Komplexität der geschuldeten Leistung beiträgt.
Wir vertreten hier die Auffassung, dass komplexe Langzeitverträge regelmässig werkvertraglichen Charakter haben und dauerhafte Arbeitsergebnisse beinhalten, die einer Wartung und Instandhaltung unterliegen. Des Weiteren sind an komplexen Langzeitverträgen immer eine Vielzahl von Teilnehmern und Sub-Vertragspartnern beteiligt, oft auch die Vertragsgegenseite selbst, die sich aktiv in die Vertragserfüllung einbringt. Der komplexe Langzeitvertrag ist somit kein klassischer Austauschvertrag, dem das Synallagma hier Leistung dort Gegenleistung zugrunde liegt, sondern ein Konstrukt mit kooperativen Elementen. Die Parteien sind sich bewusst, dass das Wissen, das im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhanden ist, keineswegs für eine abschliessende Spezifikation der Arbeitsergebnisse ausreicht. Diese Voraussetzung hat zur Folge, dass komplexe Langzeitverträge regelmässig substanzielle Änderungen des Anforderungskataloges auslösen, sei es, weil Anforderungen technisch inkonsistent oder unvollständig sind oder weil neue Anforderungen auftauchen. Die lange Frist, auf die komplexe Langzeitverträge ausgelegt sind führt zudem dazu, dass Normen und gesetzliche Grundlagen vor Abnahme der Arbeitsergebnisse ändern können und Anpassungen erfordern.
FV-Dosto – Typus eines komplexen Langzeitvertrages
Ein Blick in den Werkliefervertrag der SBB mit Bombardier betreffend Fernverkehrs-Doppelstockzügen in seiner finalen Version vom 5.5.2010 bestätigt die vorstehend aufgeführten Merkmale eines komplexen Langzeitvertrages.[1] Er ist zunächst auf eine Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt, ein Zeithorizont, der jenseits vernünftiger Planung liegt. Baugruppen besitzen die geforderte Lebensdauer, während derer die Lieferantin die „Funktionstüchtigkeit“ dieser Komponenten „garantiert“. Dies auch, dann wenn für die besagten Komponenten längere Gewährleistungsfristen gelten als für jene des Fahrzeuges als Ganzes (3 Jahre nach Abnahme). Die garantierte Funktionsfähigkeit der Komponente ist gewährleistet, wenn diese im Verlauf ihrer garantierten Lebensdauer zumindest repariert bzw. in Stand gestellt werden kann. [2]
Am Projekt sind neben der Lieferantin mindestens 23 Subunternehmer beteiligt, die strategische Baugruppen abdecken, die im Fahrzeug verbaut werden. Insgesamt wurden 70 Lieferanten in die Risiko-Management Prozesse eingebunden, wobei bei den Baugruppen Bioreaktor und Zugsicherungssysteme Monopole festgestellt wurden. Aus dieser Vielzahl von Projektbeteiligten erwächst ein komplexes Netzwerk mit netzartig verbundenen Verträgen. Statt allerdings die Vielzahl von Verträgen materiell und prozessual zu harmonisieren und einem Dachvertrag zu unterwerfen werden alle einzelnen Verträge als separate Verträge betrachtet ohne Blick auf das finale und globale Arbeitsergebnis.
Ein weiteres Merkmal des komplexen FV_Dosto Langzeitvertrages ist sein umfangreicher Anforderungskatalog bei Vertragsschluss (mit weitreichenden vertraglichen Konsequenzen) und später während und gegen Abschluss und Abnahme der Arbeitsergebnisse. So war im Vorfeld der Ausschreibung von einem „Wunschkatalog an das Christkind“ die Rede, von mehr als 1000 Preisen, die der Anbieter rechnen musste (SER, 5/2010, S. 227), von 200 Anspruchsgruppen, die in der Maquettenphase gegen 1000 Verbesserungsvorschläge zum Design und Konzept des Fahrzeuges einbrachten. Dass sich unter diesen Umständen die Komplexität des Projektes potenziert, liegt auf der Hand. Parallel zum Anstieg der Komplexität des Projektes steigt die Notwendigkeit von Change Orders mit schwierigen Verhandlungen über Zeit und Geld.
Schliesslich ist das kooperative Momentum des Vertrages offensichtlich. Die SBB verhält sich nicht wie ein „vertrauensvoller“, passiver Besteller, der bei einem qualifizierten Unternehmer ein Werk bestellt. Stattdessen greift die SBB sehr aktiv ins Geschehen ein, kontrolliert und auditiert jede Handlung des Unternehmers, um ja sicher zu sein, dass der Vertrag auch erfüllt wird. Dieses Verhalten weicht vom klassischen Austausch von Leistungen ab und führt zur grotesken Situation, dass der Unternehmer zwar für die gehörige Vertragserfüllung verantwortlich ist, faktisch aber vom Besteller permanent Weisungen erhält, die ihn in seinen Handlungen einschränken.
Komplexe Langzeitverträge im BöB?
Zu Recht schreibt Straub: „Daher müssen insbesondere jene Vorgaben bereits in der Ausschreibung festgelegt werden, welche für den Entscheid zur Teilnahme am Beschaffungsverfahren der Offerten relevant sind. Bei komplexen Leistungen ist dies mitunter praktisch unmöglich.“[3]
Es ist nicht erstaunlich, dass das Vergaberecht zwar für alle Kategorien von Ausschreibungen
gilt, ob sie nun komplex sind oder banal, grosse oder kleine Auftragswerte beinhalten, zu einfachen Kauf- bzw. Lieferverträgen führen oder zu Langzeit-Werklieferverträgen mit komplizierten Netzwerken. Das Vergaberecht kann und will diese. Unterscheidung nicht treffen, weil es primär einen diskriminierungsfreien, d.h. abschliessenden und konsistenten Zugang zu Ausschreibungen gewährleisten will. Das Eingeständnis, dass dies bei komplexen Leistungen nicht möglich ist rechtspolitisch unvertretbar.
Immerhin sieht das BöB bei „komplexen“ Aufträgen das sogenannte Dialogverfahren vor (Art. 24 BöB), das als Eingeständnis der Überforderung der Beschaffungsstelle verstanden werden kann. Die Praxis zum Dialogverfahren steht allerdings noch in den Kinderschuhen.[4]
Fazit
Trotz einer wachsenden Regulierungsdichte, umfangreicher Vertragsdokumente und zahlreicher Vertragsanpassungen im Projekt bleiben „komplexe“ Ausschreibungen eine Herausforderung. Das Beispiel FV_Dosto zeigt exemplarisch wie stark das effektiv vereinbarte Synallagma des Vertrages – hier Leistung dort Gegenleistung – von der Vertragswirklichkeit eines komplexen Netzwerkes von Projektbeteiligten abweicht. Der siegreiche Lieferant bleibt in der Pflicht, einen volatilen Vertragsgegenstand rechtzeitig abzuliefern, ohne dass er exklusiv und eigenverantwortlich das Geschehen beeinflussen und das Werk vollenden kann.
Anschrift des Verfassers:
Bertrand Barbey, Dr.oec. HSG, lic.iur.
RailöB GmbH, bertrand.barbey@railoeb.ch
[1] Die einschlägigen Bestimmungen des Vertrages unterliegen der Geheimhaltung. Wir verzichten hier entsprechend auf Verweise, sind aber bereit auf Rückfragen mit weiteren Hinweisen zu reagieren.
[2] Der WLV unterscheidet zwischen der «garantierten Funktionsfähigkeit» in der verlängerten Garantiefrist und den Mängeln der Baugruppe, die nach Ablauf der allgemeinen Garantiefrist von 3 Jahren nach Abnahme von der. SBB zu tragen sind. Damit sind schwierige Abgrenzungsfragen vorprogrammiert, wenn die Baugruppe vor Ablauf ihrer Lebensdauer nicht mehr instand gestellt bzw. repariert werden kann. Führen dann nicht einfach gravierende Mängel der Baugruppe zu diesem Ergebnis?
[3] Wolfgang Straub, Beschaffung komplexer Leistungen zwischen Vertragsfreiheit und Beschaffungsrecht, AJP/PJA 11/2005
[4] https://www.digitale-nachhaltigkeit.unibe.ch/unibe/portal/fak_naturwis/a_dept_math/c_iinfamath/abt_digital/content/e90971/e904271/e931721/e931915/e931932/e931949/e931959/008Foliensatz_Referat_Betrand_Barbey_ger.pdf