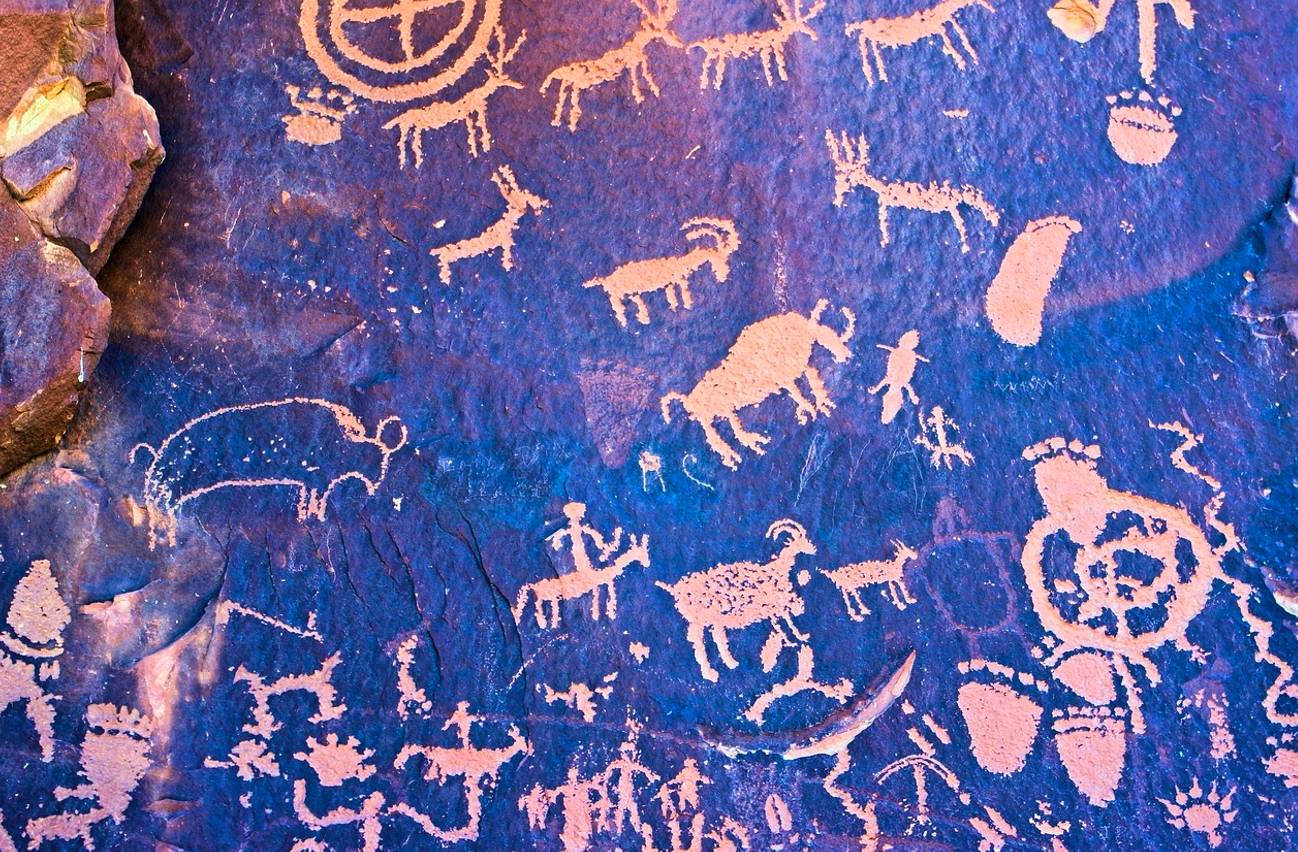Die Novellen zum Vergaberecht auf Stufe Bund und Kantone wecken Erwartungen, denen sie kaum gerecht werden können. Statt Bagatellbeschaffungen liberaler zu behandeln und bei grossen Langzeitbeschaffungen der Spezifikation und Nachvollziehbarkeit des Zuschlages mehr Beachtung zu schenken, differenziert das neue Recht in keiner Weise zwischen Kauf, einfachen Werkverträgen und komplexen Langzeitverträgen. Mit dem Ergebnis des Zuschlages, dem unterschriebenen Vertrag setzt sich keine einzige Bestimmung der Novellen auseinander.
Beschaffung als „terra incognita“
Das Vergaberecht unterscheidet zu wenig zwischen repetitiven Kaufverträgen und komplexen, neuartigen Langzeitverträgen. Der Kauf von Büromaterial für die Bundesverwaltung ist eine andere Herausforderung für die Beschaffungsstelle, als die Planung und Umsetzung einer Rollmaterialbeschaffung für Fahrzeuge, die 40 Jahre im Einsatz sein sollen. Ein Hochgeschwindigkeitszug, der neu die Zentren im Stundentakt verbinden soll und in allen DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) in 12 verschiedenen Fahrzeugtypen homologiert werden soll ist in weiten Teilen «terra incognita», womit auch gesagt ist, dass der Zuschlag in Unkenntnis zahlreicher Anforderungen, deren Plausibilität und Erfüllbarkeit und damit Änderungsbedürftigkeit erfolgt. Auf dieser Grundlage kann kein Zuschlag erfolgen, der dem Zweck des Vergaberechtes, insbesondere der geforderten Wirtschaftlichkeit, Gleichbehandlung und Transparenz genügt.
Das Nachtragswesen muss so zwangsläufig florieren. Ein Beschaffungsobjekt, das im Rahmen seiner Entwicklung Hunderte von Änderungsanträgen generiert, wovon jene der Beschaffungsstelle jeweils dominieren, schafft auf kaltem Wege einen Mehraufwand für die Parteien, der kaum abschätzbar ist. Die Grundidee des Vergaberechts ist eine stabile Beschaffung nach den publizierten Zuschlagskriterien, nicht aber ein Änderungswesen, das freihändig vergebenen Nachträgen jenseits der Schwellengrenzen Vorschub leistet.
Was an Normen nur so «kreucht und fleucht» (Stöckli)[1]
Stöckli verweist im Zusammenhang mit dem Nachtragswesen auf die problematische Berechnung des Nachtragspreises. Die dazu angebotenen Konzepte der Detailkostenausweisung bzw. Einsichtnahme in die Preisbildung zur Ermittlung eines korrekten Nachtragspreises bleiben ihren Tauglichkeitsbeweis schuldig und erinnern an die spätmittelalterlichen Bemühungen zur Ermittlung des «justum pretium». Stöckli beklagt die einer vernünftigen Auslegung kaum mehr zugänglichen Verträge, in die oft an Normen hineingestopft wird, was da «kreucht und fleucht». Unter diesen Umständen fällt auch die Frage ins Gewicht, ob es sich um eine echte Änderung handelt, d.h. um eine eindeutige Abänderung der bestellten Leistung oder ob es sich bloss um eine Klärung einer auslegungsbedürftigen Anforderung handelt. Je nach dem sind neben dem quantitativen und temporalen Impact der Änderung auch die Frage strittig, wer für die Änderung aufkommen muss.
FV-Dosto als Beispiel
Bereits in der Ausschreibungsphase mehrten sich die kritischen Stimmen zum Anforderungsinhalt des neuen Fernverkehrs-Doppelstockzuges. So glich die Ausschreibung eher einem «Wunschkatalog an das Christkind», der «alles, was man sich in einem Zug vorstellen kann und als Stand der Technik gilt als Option oder Variante» beinhaltete.[2] Mehr als 1000 Preise mussten die Anbieter berechnen, eine kaum mehr überblickbare Flut von finanziellen Bewertungskriterien. Die Widerspruchsregel im Werkliefervertrag (Ziff. 3.2 WLV) war mehrstufig. So stand der Vertrag mit seinen 31 Anhängen zuoberst, gefolgt vom Angebot der Lieferantin, den Ausschreibungsunterlagen und schliesslich den technischen Spezifikationen (gesetzliche Vorschriften, Normen, Regeln UIC und SBB). Damit war die Schleuse offen für eine Werklieferung, deren Inhalt wohl niemand im Zeitpunkt des Zuschlages abschätzen konnte.
Unter diesen Umständen muss das Nachtragswesen florieren: Aus einer einfachen Anforderung wird nun eine komplizierte. Neue Vertragsinhalte müssen vereinbart werden. In mühsamem Hin und Her einigen sich die Vertragsparteien auf den richtigen und v.a. richtig kalkulierten Nachtrag. Die Detailkostenausweisung des Vertrages soll den fairen und gerechten Nachtragspreis garantieren. Am Ende ist sie nur ein Hindernis mehr auf dem Weg zur zeitgerechten Erfüllung des Vertrages.
Ein Beitrag von RTS1 vom 2. Juni 2014 über den Standort Villeneuve vermittelt ein Bild vom wachsenden Druck, den ein ausuferndes Nachtragswesen im Langzeitvertrag verursachen kann. Vor dem Hintergrund stark gestiegener Pendlerströme und Tarife wartet das Bahnland Schweiz ungeduldig auf den Paradezug, von dem Linderung erwartet wird. Gleichzeitig erhofft sich die Region vom Projekt eine Rückkehr zu industrieller Grösse (AMCV). Ein riesiger Kraftakt für Bombardier, einerseits mit diesem öffentlichen Druck umzugehen, und andrerseits wertvolle Zeit in ein administrativ anspruchsvolles Nachtragswesen zu investieren, und dies mit einem Partner, der mit Pönalen in astronomischer Höhe von CHF 300M droht, die jede Aussicht auf künftigen Gewinn im Keime ersticken. Wahrlich eine Herkulesaufgabe.
Fazit
Es ist zu bedauern, dass das Problem der Nachtragslastigkeit von komplexen Langzeitprojekten vergaberechtlich tabuisiert wird. Wie kann es sein, dass der Lieferant alle Konsequenzen eines unzulänglichen Ausschreibungsprozesses selbst zu tragen hat, wenn sich zwar ein Anforderungs-katalog als unvollständig, widersprüchlich und teilunmöglich erweist, der Lieferant aber in weiten Teilen vor der Alternative steht risikoreiche Muss-Anforderungen zu akzeptieren oder auf die Offerte zu verzichten. Der einzig vernünftige Ausweg aus diesem Dilemma wäre ein Eingeständnis der fachlichen Defizite auf beiden Seiten der Ausschreibung. Damit stünde der Weg zum Dialogverfahren frei, evtl. in Kombination mit Teilen der Beschaffung, die funktional auszuschreiben wären. Eines ist jedenfalls klar: das klassische Vorgehen mit unhaltbaren und dennoch zwingenden Anforderungskatalogen einerseits und erzwungenen Werklieferverträgen andrerseits geht nicht mehr auf.
Anschrift des Verfassers:
Bertrand Barbey, Dr.oec. HSG, lic.iur.
RailöB GmbH, bertrand.barbey@railoeb.ch